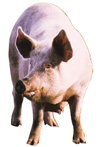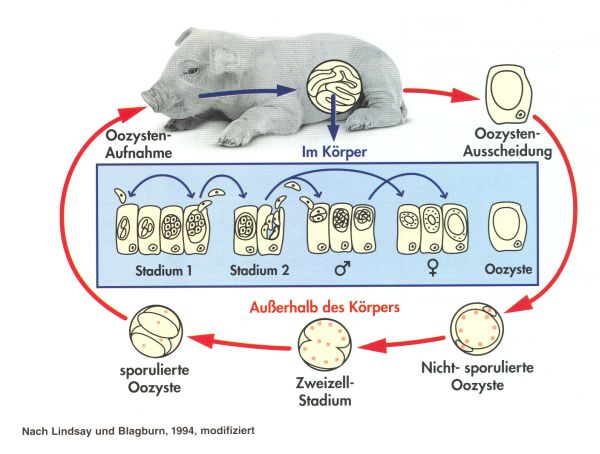Isospora suis hat den für die Kokzidien typischen Entwicklungszyklus, bei dem die
ungeschlechtliche und geschlechtliche Vermehrung ausschließlich in einem Wirt erfolgen, d.h. nicht
zum Teil in einem Zwischenwirt (wie z.B. bei der Vermehrung von Toxoplasma gondii)(3). Infektionsfähige,
mikroskopisch kleine Oozysten (ca. 20 mm im Durchmesser) werden von Ferkeln im empfänglichen Alter oral
aufgenommen. Das Zielorgan von Isospora suis ist der Dünndarm, wo sich der Parasit in der
Darmschleimhaut vermehrt (1 - 3). Nach Aufnahme der sporulierten Oozysten aus der Umwelt kommt es
zunächst unter Einfluss von Magensäure, Verdauungsenzymen und CO2 zur Exzystierung und damit zur
Freisetzung der Sporozoiten aus den Sporozysten in das Dünndarmlumen (4). Die Sporozoiten dringen in
Darmschleimhautzellen des Dünndarmes (Jejunum und Ileum) ein und vermehren sich in erheblichem Maße
ungeschlechtlich durch Zellteilung (4). Nur bei schweren Infektionen ist auch das Colon (Dickdarm)
betroffen (4). Diese ungeschlechtliche Vermehrung (Merogonie) kann zwischen ein- und dreimal
stattfinden (4, 5).
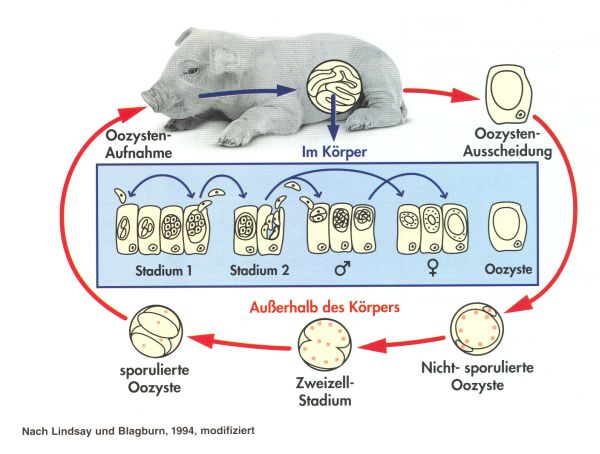
Anschließend werden weibliche und männliche Parasitenstadien - weibliche Makrogamonten und männliche
Mikrogamonten - gebildet (5). Nach Befruchtung wird eine Oozyste gebildet, die mit den Faezes in die
Aussenwelt ausgeschieden wird. Da sowohl die ungeschlechtliche als auch die geschlechtliche Vermehrung
intrazellulär ablaufen und mit dem Untergang der betreffenden Wirtszelle einhergehen, werden große Teile
der Darmschleimhaut zerstört (3). Kot infizierter Schweine enthält > 100.000 Oozysten pr. g. Kot; nur 100
Oozysten sind ausreichend, um eine klinische Kokzidiose auszulösen.
Damit beginnt der exogene Teil der Entwicklung, die Sporogonie (4). Die mit dem Kot ausgeschiedenen
Oozysten müssen außerhalb des Wirtes sporulieren, um so das infektiöse Stadium zu erreichen (4). Die
ausgeschiedenen Oozysten sporulieren unter geeigneten Umweltbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit,
Sauerstoff) und sind nach ein bis drei Tagen wieder infektiös (3,5). Für Isospora suis liegen die
optimalen Temperaturen zwischen 30 und 37°C. In diesem Bereich kann die Sporulation am schnellsten
stattfinden (4). Bei Temperaturen, die oberhalb von 40°C oder unterhalb von 20°C liegen, kann keine
Sporulation stattfinden (4). Nach der Sporulation enthält die Oozyste zwei Sporozysten mit je vier
Sporozoiten (4). Sie ist nun infektiös und kann nach oraler Aufnahme einen neuen Entwicklungszyklus
einleiten (5).
Von wesentlicher Bedeutung für das Infektionsgeschehen in einem Ferkelerzeugerbestand ist, dass
Oozysten außerordentlich resistent gegenüber Umwelteinflüssen sind. Sie lassen sich auch mit sehr
aufwendigen Maßnahmen nicht völlig eliminieren und stellen, da sie auch außerordentlich lange
infektionsfähig bleiben (zumindest über Monate), eine Gefahr dar, wenn sie einmal in einem Bestand
sind (3).
Literatur:
(1) Meyer, C., A. J Joachim u. A. Daugshies, (1999):
Occurrence of Isospora suis in larger piglet production units and on specialized piglet rearing farms.
Vet. Parasitol. 82, 277-284.
(2) Daugshies, A., C. Meyer u. A. Joachim (1999):
Vorkommen von Isospora suis in Ferkelerzeuger- und Ferkelaufzuchtbetrieben.
Prakt. Tierarzt 6, 530-537.
(3) H.- C. Mundt und A. Daugschies
Die Saugferkelkokzidiose - eine häufige Durchfallerkrankung
Handbuch der tierischen Veredelung, Verlag Kamlage Osnabrück
(4) Larsen K.
Isospora suis. Porcine neonatal coccidiosis.
Veterinaertidsskrift. 1996;79:387- 392.
(5) Mundt HC, Koudela B.
Don't forget coccidiosis.
Pig Progress Parasites Special. 2001:3-5.
|